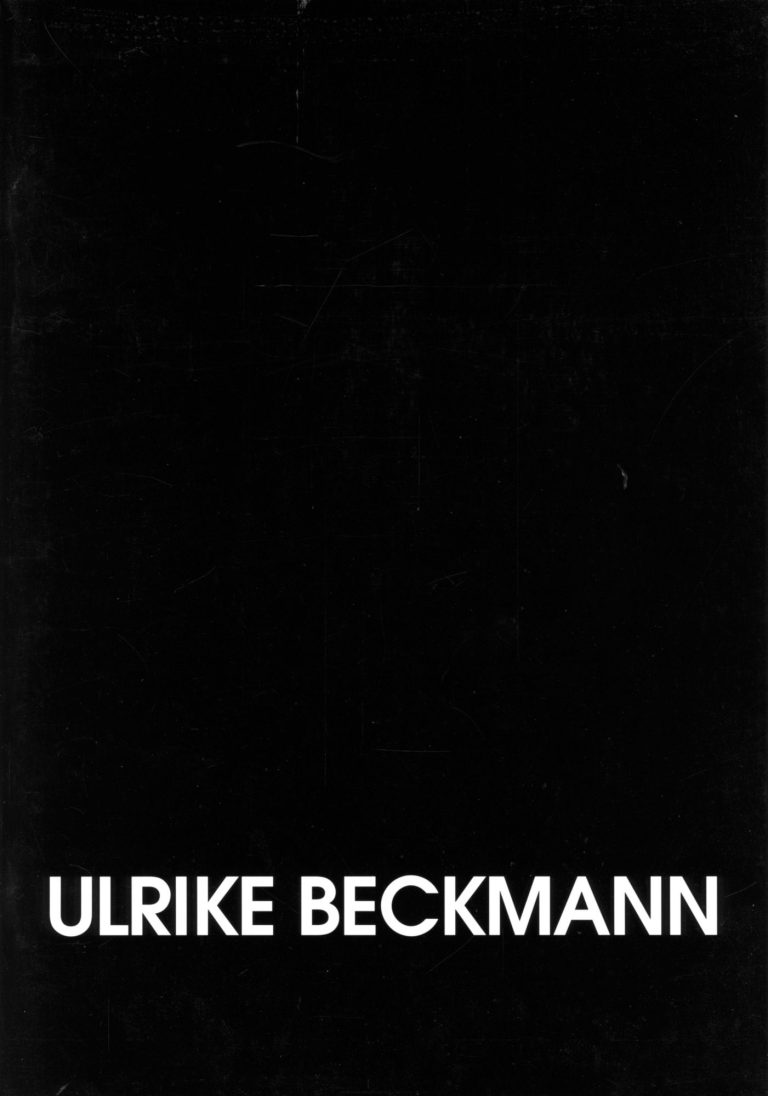Kultur wirkt.
Hans Knopper M.A.
Ulrike Beckmann
Köpfe und so weiter
Ausstellungskatalog Galerie Kappler Darmstadt:
Ulrike Beckmann. Köpfe und so weiter. Bilder
mit einem Text von Hans Knopper.-
24 S., 29,5 x 21 cm.-
Ausstellung 1994.
Text von Hans Knopper:
Bild undWelt
Von der Philosophie des Malens in den Bildern von Ulrike Beckmann
Beinahe als Schlußbetrachtung schreibt Ludwig Wittgenstein 1921 in seiner Logisch-philosophioschen Abhandlung, in der er ganz im Sinne des Positivismus zu beweisen versucht hat, daß alle Urteile nur Ableitungen von Tatsachen sind, folgende Sätze:
"6.52
Wir fühlen, daß selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch dar nicht berührt sind. Freileich bleibt dann eben keine Frage mehr; und eben dies ist die Antwort.
6.521
Die Lösung des Problems des Lebens merkt man am Verschwinden des Problems. (Ist dies nicht der Grund, warum Menschen, denen der Sinn des Lebens nach langen Zweifeln klar wurde, warum diese dann nicht sagen konnten, worin dieser Sinn bestand?)"²
Genau an dieser Stelle, an der Wittgenstein seine Überlegungen abbrechen läßt, beginnt die Welt der Kunst. Sie bewegt sich in genau den Bereichen, die sprachlich nur schwer darstellbar sind und über die man nach Wittgenstein deshalb nur schweigen kann.³ In der Kunst werden die jenseits dieser Grenze gemachten Erfahrungen und gewonnenenen Erkenntnisse als malerische Spuren sichtbar. Beinahe seismographisch werden die Einsichten und Irrtümer des Malers aufgezeichnet und auf der Leinwand, auf dem Papier für den Betrachter offenbar. Vor allem jene Formen der bildenden Kunst, die über die reine Abbildung von Gegenständen hinausgehen und dem expressiven Ausdruck Raum geben, lassen den Betrachter der Anschauung des Künstlers teilhaftig werden. Das Gemälde oder die Zeichnung bildet den Findungsprozeß des suchenden Künstlers ab.
Vor diesem Hintergrind wollen die Arbeiten Ulrike Beckmanns verstanden werden. Ihre Bilder sind selten gegenstandsfrei. Figuren, Silhouetten, Schatten, Köpfe, Leitern, Fenster sind teils auf den ersten Blick, teils nach längerem Sehen zu erkennen. Nicht dem Gegenstand selbst, sondern der Art ihrer Verknüpfung miteinander, der Art des Bezuges, den sie untereinander und zum umgebenden Raum haben, wird malerisch nachgeforscht. Teilweise sind Handlungen oder Gegenstände im Bild sprachlich benannt. Sprechen, Schweigen, Nase etc. Diese Sprachbilder im gemalten Bild befreien das Auge des Betrachters vom Zwang der Gegenstandssuche. Der Blick wird frei für eigene Wege, für die Wahrnehmung der Spannungen zwischen den Personen, zwischen den Bildbereichen. Die schwarzen oder weißen Linien werden als definierende Umrisse von einer unbestimmten Tiefenräumlichkeit erkannt. Diese Linien der Erkenntnis wachsen in die zunächst unbestimmten Bildbereiche hinein. Im Bild "Schatten" von 1993 gehen von einer menschlcihen Gestalt parallele Linien aus, die die Bildfläche zu erkunden scheinen. Die Linien erinnern an Leitern, wie sie in vielen Bildern Beckmanns eine Rolle spielen. Die beginnende Verknüpfung der Bildfläche wird auch durch die einander gegenüberstehenden Farbflächen aus Blau und Orange betrieben: kleine Farbinseln beginnen die Konfrontation abzuschwächen und die Kontraste auszugleichen.
Die Leiter kann als Symbol für die Verbindung von oben und unten, von Himmlischen und Irdischem angesehen werden. Wittgenstein, auf den die Malerin sich häufig beruft, benutzt das Bild von der Leiter der Erkenntnis, die man wegzuwerfen hat, nachdem man auf ihr aufgestiegen ist. Man übewindet die Leiter, um zu wahrer Erkenntnis zu gelangen. Auf den Künstler übertragen bedeutet dies, daß er die Überwindung seiner formalen Gestaltungsmittel anzustreben hat, um zu wahren Aussagen zu kommen. So wie die Beantwortung der Fragen der Wissenschaft die Lebensprobleme nicht berührt, so kann die konkrete Anwendung formale Gestaltungsgestze nicht das Künstlerische im Bild ersetzen.
Jüngst hat Ulrike Beckmann eine Serie von Köpfen gemalt. Sie malt dabei nicht die Oberflächenformen, die auf charakteristische Besonderheiten verweisen und sie löst auch kein Porträt im klassischen Sinne, sondern es entstehen Farbereignisse. Deren Formen werden in Teilen zu Köpfen zusammengefaßt, andere Teile bilden hierzu abstrakte Gegenüber. Inneres des Kopfes und äußere Umgebung gehen ineinander über und bedingen sich gegenseitig. Die Köpfe sind Ort der Entstehung der Welt. Sprossen sind ihnen gelegentlich beigegeben, um symbolisch als Leiter die Grenzen des Formulierbaren zu markieren, oder um als Fenster einen Ausweg in eine dahinterliegende Realität anzubieten?
Hans Knopper
² zitiert nach Wittgenstein, Ludwig: Tractatus logico-philosophicus. Logisch-philosophische Abhandlung.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1978, S. 113 f.
³ a.a.O., S. 114